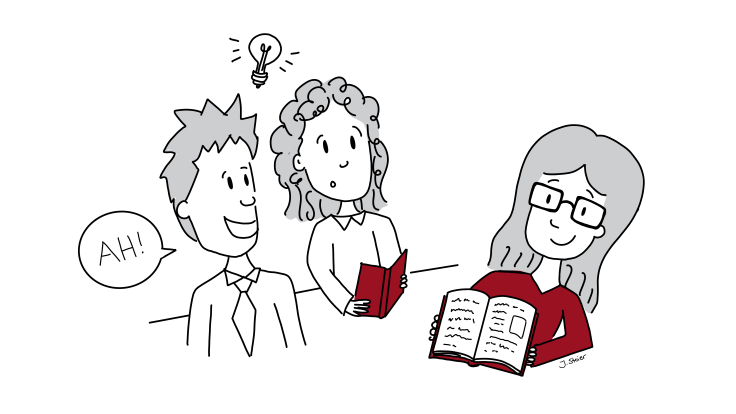Kernfrage ist, wie sich vor dem Hintergrund von IT-Nutzung der Staat mit seinen Aufgaben und Steuerungsverständnis insgesamt ändert? Was bedeutet zukünftig Staatlichkeit und wie verändern sich staatliche Steuerungsmechanismen, wie z.B. Big Data oder Predictive Society. Oder provokant gefragt: Wird der Staat „wegdisruptiert“ oder gar „a-politisch“, weil nur noch ein mehr oder weniger funktionierender Algorithmus über die Politik und dessen Ausführung entscheidet? Hier geht es nicht mehr oder minder um die Fragen eines zukünftigen Staatsverständnisses mit seinen legitimationssichernden Strukturen und Mechanismen, die durch Digitalisierung wie auch andere Entwicklungen herausgefordert werden. Weitergehend stellen sich die Fragen: Wie verändert IT die klassischen Prinzipien der Staatsorganisation? Was sind mögliche und notwendige Veränderungen in Bezug auf Föderalismus, Selbstverwaltung und Ressortprinzip?
Um die Potenziale von Informationstechniken überhaupt zu verstehen, müssen Arbeitsorganisation und Abläufe der Verwaltung betrachtet werden. Forschung im „Maschinenraum“ des Staates ist angesagt. Als Forschungsfeld bisher unterschätzt, dafür mit weitreichenden Implikationen für Führung und instititutionelles Verstehen. Wie verändert sich die Arbeitsorganisation? Wird wirklich alles automatisiert und standardisiert? Wie können Arbeitsformen geschaffen werden, welche die Motivation der Beschäftigten auf Dauer fördern und erhalten und wie können die Beschäftigten besser einbezogen werden? Wie verändern sich die Wissensanforderungen sowie Fähigkeiten und Fertigkeiten der Beschäftigten? Digitalisierte Arbeitsorganisationen unterscheidet sich zwischen der klassischen Optimierung der Arbeitsorganisation, insbesondere durch E-Akte, dann die vernetzte Arbeitsorganisation, wie durch Shared Service Center oder als drittes die algorithmisierte Arbeitsorganisation durch Einbindung von KI oder Big Data. Es geht dabei nicht nur um die Einführung von IT, sondern erfordert eine aktive Gestaltung und Einbeziehung von Organisation und Personal – von Anfang an.
Öffentliche Aufgabenerledigung vollzieht sich insbesondere vor dem Hintergrund von IT-Nutzung immer mehr in vernetzten Arrangements an denen private wie öffentliche Akteure gleichermaßen beteiligt sind. Solche organisatorischen Vernetzungen basieren auf IT-Infrastrukturen, die ihrerseits wieder vernetzt sind. Diese Vernetzungsarten nehmen zu, sind anspruchsvoll in der Gestaltung und Umsetzung, weil insbesondere Zuständigkeiten/Verantwortungen sowie die Steuerungsfähigkeit gesichert sein müssen. Gleichzeitig verändert es Führung während und nach der Umsetzung, die nicht mehr an Organisationsgrenzen stoppt. Gefragt ist transformative Führung, vielfach über Distanz hinweg. Deshalb ist das Management von neuen digitalisierten Organisationsformen mit dem Einführungsmanagement eine besondere Herausforderung, die der öffentliche Sektor zunehmend zu bewältigen hat. One Stop Government, Shared Service Center sind nur zwei Ausprägungen von vernetzten Organisationsformen.
IT ist heute in Entwicklungsländern nicht mehr wegzudenken. Digitalisierung ist ein zentrales Element in diversen Projekten, um generell Entwicklung, Lernprozesse und institutionellen Wandel zu ermöglichen. Informationstechniken dienen auch in Verwaltungen von Entwicklungsländern, um funktionierende staatliche Strukturen zu schaffen, die wiederum Voraussetzung sind für Stabilität und ökonomische wie soziale Entwicklung. Ob mehr Transparenz, Nachvollziehbarkeit oder schnelle Prozesse, IT ist Grundlage für gutes Regieren und Verwalten. Relevante Fragen sind: Was sind angepasste Modelle für Entwicklungsländer? Wie kann IT mit Dezentralisierung verbunden werden? Wie können in einer anders gearteten Verwaltungskultur (z.B. Neopatrionialismus und Nepotismus) Digitalisierungskonzepte für den Staat wirken? Wie kann der Zugang in ländlichen Regionen zu öffentlichen Dienstleistungen verbessert werden? Welche Instrumente bietet die Digitalisierung um „failed State“ zu überwinden?
Akzeptanz tritt auch bei der Einführung von an sich „guten Lösungen“ nicht von selbst ein, sondern variiert je nach individuell wahrgenommenem Nutzen-Aufwands-Empfinden. Gefragt ist daher ein integrierter Ansatz, der alle Faktoren, an denen sich die Einstellung der Benutzer gegenüber der Anwendung bildet, systematisch in den Blick nimmt. Mit der vom SHI entwickelten Methode Akzepto wird konkret ermittelt, wie Beschäftigte mit IT-Tools/ der eAkte im Kontext ihrer Arbeitsorganisation umgehen und was mögliche Ursachen für eine geringe oder noch nicht ausreichende Akzeptanz sind.
Design Thinking ist ein Ansatz zur Problemlösung, der die Bedürfnisse der Zielgruppe mit überzeugenden Lösungsvorschlägen und Umsetzungsideen adressiert. Vorteil dieses Ansatzes: Aus Anwender- bzw. Bürgersicht entwickelt und durch die Projektverantwortlichen selbst im Team erarbeitet, lassen sich die Ergebnisse einfach in Konzepte und Umsetzungspläne überführen.
Design Thinking ist in drei Phasen unterteilt:
(1) Inspirationsphase, in welcher die Bedürfnisse der Zielgruppen erarbeitet werden
(2) Phase der „Ideation“, in der gemeinsam Lösungsideen entwickelt, bewertet und priorisiert werden
(3) Implementationsphase, in der „Prototypen“ für Lösungsideen entwickelt werden.
PROVE ist eine vom SHI entwickelte wissenschaftlich abgesicherte und praxisbewährte Methode zur systematischen und stufenweisen Erfassung, Analyse und Bewertung von öffentlichen Aufgaben, Leistungen und Prozessen. Mittels PROVE werden öffentliche Aufgaben durch (teil-) standardisierte Fragen so bewertet, dass strukturierte Handlungsempfehlungen unter Berücksichtigung von Machbarkeitsüberlegungen abgeleitet werden können. Gleichfalls kann PROVE Modernisierungsprojekten in unterschiedlichen Anwendungsbereichen, z.B. eAkte oder neuen Formen der Kooperation, vorangestellt werden, um zu verhindern, bürokratisch geprägte Abläufe einfach nur zu digitalisieren.
Der Action-Design-Research-Ansatz (ADR), der vielfach für Organisations-, Modell- oder Softwareentwicklung zum Einsatz kommt, wird beim SHI an der Schnittstelle zur Praxis angewendet. ADR ist so konzipiert, dass die „Stimmen der Praxis“ gezielt einbezogen werden, so dass praxisnahe und anwendungsgerechte Lösungen entstehen. Konkret werden die Anforderungen der Praxis bereits in der Gestaltungsphase einbezogen und Entwicklungsschritte wiederkehrend evaluiert.
Daraus ergeben sich für das Vorgehen vier Stufen:
(1) Problemanalyse
(2) Entwicklung von Gestaltungsansätzen
(3) Evaluation
(4) Weiterentwicklung der Gestaltungsansätze
Über die Szenariomethode lassen sich plausible, kohärente und voneinander abgrenzbare mögliche Zukunftsbilder entwickeln und zugleich Zukunftsräume systematisch erforschen. Die Entwicklung von Extremszenarien ermöglicht es, den größtmöglichen Gestaltungs- und Denkspielraum zu eröffnen. Mit der Methode wird Orientierungswissen (Preparedness) erzeugt, um strategische Entscheidungen vorzubereiten, potenzielle Chancen und Risiken frühzeitig zu erkennen und konkrete Handlungsmöglichkeiten und Maßnahmen abzuleiten. Das Orientierungswissen ermöglicht eine bewusste Gestaltung der Transformation und schützt vor technik- und trendgetriebenem Aktionismus.
Mit der vom SHI entwickelten GoSeP-Methode wird in einem dynamischen Verfahren systematisch identifiziert, priorisiert und analysiert, welche Lebenslagen und Leistungen welche Aufwände erzeugen. Daraus wird beispielsweise abgeleitet, welche Leistungen durch eine neue Form der Leistungserbringung mit und ohne IT profitieren. Den Kern bilden dabei über 40 Lebenslagen, die basierend auf soziodemografischen und wirtschaftlichen Daten sowie nach strategischer Relevanz beurteilt werden. Hierdurch wird es für die Verwaltung leicht möglich, ein nachfrageorientiertes Angebot zu schaffen.
PSME misst, illustriert und analysiert die Public Service Motivation, das Engagement und die Zufriedenheit der Beschäftigten innerhalb einer Organisation. So werden u.a. potenzielle Einflussfaktoren und Handlungsempfehlungen für organisatorische und personalmanagementspezifische Maßnahmen ermittelt. Was muss neu gestaltet werden damit die Motivation in digitalisierten Strukturen steigt? Worauf kommt es an? Die Verwaltungspraxis erhält strukturiert Hinweise zur Gestaltung von Führung, Organisation und Personal.
Ansprechpartner Fragen oder Interesse?!

Wissenschaftlicher Direktor
Tino Schuppan ist Professor für Public Management an der HdBA. Seine wissenschaftlichen Arbeiten konzentrieren sich auf die Digitalisierung von Staat & Verwaltung sowie auf ausgewählte Public-Management-Themen. Zudem ist er im Editorial Board von Verwaltung & Management, Information Polity und Government Information Quartely.
Melden Sie sich bitte bei Professor Schuppan wenn Sie:
- Fragen zu unseren Forschungsthemen haben.
- Interesse an einem Gutachten, einer Studie oder einer Forschungskooperation haben.
- Fellow des Stein-Hardenberg Instituts werden wollen.
- Artikel in Verwaltung & Management veröffentlichen wollen.