
22. September 2025 RegioProzess im Fokus: Hinter den Kulissen eines Forschungsprojekts
Dass Mobilitätsplanung in einer Kommune kompliziert sein kann, konnten wir schon in unserem Forschungsprojekt KoRa feststellen. Doch: Wie ist es dann erst, wenn nicht nur eine, sondern fünf Kommunen und dann noch zwei Kreise an einem neuen Radweg beteiligt sind? Im Rahmen unseres Forschungsprojektes RegioProzess hat uns diese Frage quer durch Deutschland geführt, von „gleich um die Ecke“ in Oberhavel bis nach Ludwigsburg am anderen Ende der Republik. RegioProzess zielt darauf ab, die regionale Verkehrswende durch digitale Planungstools, schlankere Verwaltungsprozesse und neue Formen der interkommunalen Zusammenarbeit zu beschleunigen. In drei ausgewählten Modellregionen – dem Landkreis Ludwigsburg, der Regiopolregion Bielefeld und dem Landkreis Oberhavel – sollen bestehende Herausforderungen untersucht und exemplarisch neue Wege der Kooperation und Koordination erprobt werden. Über unsere Rolle und Arbeit als Forschungspartner möchten wir hier berichten.
Kurzübersicht RegioProzess
Das Projekt „RegioProzess“ (Laufzeit: 2024–2029) soll Probleme für die Umsetzung der Mobilitätswende bei der interkommunalen Zusammenarbeit identifizieren und Lösungen mit digitalen Planungstools und Change-Management-Ansätzen entwickeln und pilotieren. Gefördert wird es vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt und durch die Projektleitung des Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) koordiniert.
Ein Forschungsprojekt der besonderen Art
Zunächst ist RegioProzess eine Besonderheit, nicht nur für uns als Institut, sondern auch als Forschungsprojekt. Denn neben den drei Modellregionen sind wir zudem vier Forschungspartner, die alle unterschiedliche Stärken und Expertisen mit einbringen: das Deutsche Institut für Urbanistik, experience consulting, FixMyCity und das SHI. Damit müssen nicht nur sieben Akteure koordiniert und regelmäßig zusammengebracht werden, das Ganze muss auch über den außergewöhnlich langen Projektzeitraum von fünf Jahren geschehen. Aber eben dies ist auch der Vorteil von RegioProzess: Nicht nur, dass wir in fünf Jahren Analysen und Untersuchungen durchführen können – wir sind so auch in der Lage, echte Veränderungen in den Modellregionen zu implementieren, zu begleiten und zu evaluieren.
Es gilt, aufeinander einzugehen
Jede:r von uns hat seine eigenen Aufgaben und Schwerpunkte im Projekt. Hier ist es wichtig, sich offen über aktuelle Wissens- oder Unterstützungsbedarfe auszutauschen und vor allem auch die jeweiligen Rahmenbedingungen, insbesondere der Modellregionen, zu kennen. Denn fünf Jahre Forschung und Erprobung mit externen Akteur:innen können gerade für die beteiligten Städte und Landkreise auch eine große Belastung sein. Überhaupt die Ausgangssituation der Modellregionen, zu verstehen und Handlungskorridore zu identifizieren, ist dabei unter anderem vor allem unsere Aufgabe in dem Projekt.
Nachdem wir uns 2024 noch intensiv dem „Desk-Research“ gewidmet hatten, konnte es diesen Januar richtig losgehen mit zunächst drei Auftaktworkshops in den Modellregionen. Gemeinsam mit einer Vielzahl an Akteuren und Stakeholdern – aus Verwaltung, Politik, Verkehrsplanung und Zivilgesellschaft – ging es zunächst darum, überhaupt ein Bewusstsein für das Projekt und die Gestaltungsmöglichkeiten der kommenden fünf Jahre zu schaffen. Und es ging um die grundlegende Frage: Was hemmt eigentlich interkommunale Zusammenarbeit – und noch wichtiger – wo liegt das Potenzial für Veränderung in uns selbst, in unseren Organisationen und den gewachsenen Verwaltungsprozessen?

Prozesse als Ausgangspunkt, nicht als Nebensache
Im nächsten Schritt haben wir uns daher Modellprojekten gewidmet, um die Zusammenarbeit in der Praxis kennenzulernen. In insgesamt sechs Workshops haben wir gemeinsam mit den regionalen Akteuren exemplarische Mobilitätsprojekte betrachtet – nicht nur als fachliche Aufgaben, sondern als Prozesse. Wer ist wann beteiligt? Wo hakt es in der Abstimmung? Welche Interessen, aber auch welche kulturellen oder organisatorischen Routinen bestimmen das Verwaltungshandeln? Solche Diskussionen lassen sich nicht aus Akten oder Organigrammen ablesen – sie müssen erlebt und gemeinsam rekonstruiert werden.
Besonders deutlich wurde: Der Aufwand, alle relevanten Akteur:innen an einen Tisch zu bringen, ist nicht zu unterschätzen. Während wir im Vorgängerprojekt KoRa noch auf städtischer Ebene arbeiteten, beschäftigen wir uns nun mit großräumigen, heterogenen Regionen, in denen Verwaltungsgrenzen, Zuständigkeiten und Routinen oft unterschiedlich sind. Ohne das große Engagement und die ausgezeichnete organisatorische Arbeit unserer Modellregionen wäre dieser Schritt nicht möglich gewesen.
Und wie visualisiert man einen Planungsprozess?
Unsere Methodik basiert auf dem Einsatz von MODULO – einer modularisierten, haptischen Prozessmodellierung, die wir gezielt für die Anwendung in der öffentlichen Verwaltung entwickelt haben. MODULO erlaubt es, Prozesse gemeinsam sichtbar und „anfassbar“ zu machen – ohne dass tiefgehende Modellierungskenntnisse vorausgesetzt werden. Dadurch entsteht nicht nur ein Ablaufdiagramm, sondern ein dreidimensionales Bild des Verwaltungshandelns: Wir erfassen nicht nur Aufgaben, sondern auch Perspektiven, Konflikte, Hemmnisse und vorhandene Ressourcen.
Der methodische Ablauf hat sich dabei bewährt: Zunächst analysieren wir vorhandene Dokumente und Daten, rekonstruieren auf dieser Basis erste Prozessmodelle und verifizieren diese dann im Dialog mit den regionalen Akteur:innen. In der Diskussion offenbaren sich oft blinde Flecken, kulturelle Spannungen oder informelle Abläufe, die in formalen Plänen nicht sichtbar wären. Aber selbst die umfassenden Prozessdiskussionen haben häufig nicht alle Themen abdecken können. Daher haben wir zusätzlich eine Vielzahl an Validierungsgesprächen mit Akteuren geführt, die nicht dabei sein konnten oder die sich im Workshop als „Externe“ dennoch wichtig für die Projekte zeigten. Hier wurde für uns deutlich, wie wichtig auch die Einbindung anderer Verwaltungsebenen sein kann, selbst wenn es bedeutet, ein Landesministerium zu beteiligen, obwohl eigentlich „nur“ zwei Radwege im Fokus stehen sollen.
Unsere Aufgabe ist nämlich nicht, Prozesse „durchzuoptimieren“, sondern Möglichkeitsräume aufzuzeigen – für bessere Kooperation, effizientere Abstimmung und nachhaltige Steuerung. Die große Datenmenge, die wir dabei gewonnen haben, liefert eine wertvolle Grundlage für die anschließende wissenschaftliche Aufarbeitung – sowohl im Projektkonsortium als auch im Forschungsbegleitkreis.
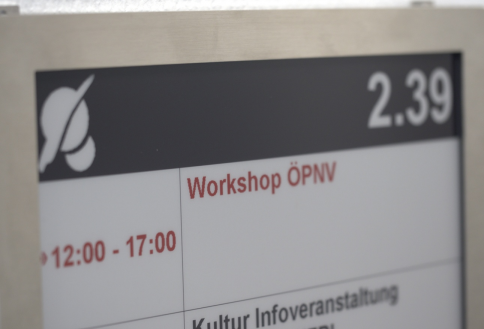
Erste Erkenntnisse – wo Mobilitätsplanung an Grenzen stößt
Einige erste übergreifende Beobachtungen lassen sich bereits jetzt aus den Gesprächen, Workshops und Diskussionen ableiten.
So zeigt sich etwa, dass Fördermittel durchaus als Katalysator interkommunaler Zusammenarbeit wirken können. Aber gerade hier stößt man dabei immer wieder auf strukturelle Spannungsfelder, etwa zwischen gewünschter Flexibilität vor Ort und vergaberechtlichen Rahmenbedingungen auf Landes- oder Bundesebene. Diese Spannungen lassen sich nicht allein durch gute Förderkonditionen auflösen. Vielmehr braucht es – wie sich in den Workshops deutlich gezeigt hat – eine intrinsische Motivation der Beteiligten auf kommunaler Seite. Der „lange Atem“ ist entscheidend, denn Förderverfahren, Planungsprozesse und Umsetzung ziehen sich über Jahre. Ohne persönliche Überzeugung und das Engagement Einzelner auf der Fachebene geraten Projekte ins Stocken.
Gleichzeitig liegt gerade hier ein Schlüssel: Interkommunale Kooperation funktioniert, wenn sie fachlich unter Gleichrangigen – unter „Peers“ – stattfindet. Fachreferent:innen, Verkehrsplaner:innen oder Projektverantwortliche bilden das Rückgrat der Zusammenarbeit – jenseits politischer oder institutioneller Hürden.
Weniger leichtgängig gestaltet sich dann hingegen oft das Verhältnis zwischen Kommunen und übergeordneten Behörden. Landesbehörden, Förderbanken oder auch der Bund werden in der kommunalen Wahrnehmung nicht selten als Hürde wahrgenommen – als Prüf- und Kontrollinstanzen, nicht als Mitgestaltende. Diese Beziehungsmuster erinnern an ähnliche Befunde aus früheren Projekten wie KoRa, wo etwa Straßenverkehrsbehörden oder Denkmalschutzinstitutionen eine vergleichbare Rolle einnahmen. Die Rolle von gegenseitigem Vertrauen und die Existenz funktionierender Kommunikationskanäle zeigt hier ihre Relevanz und ist damit auch eine der Baustellen, die wir im Projekt angehen möchten. Denn die Ergebnisse fließen nun in die gezielte Entwicklung von Planspielen, Governance-Instrumenten und digitalen Tools zur besseren Steuerung und Zusammenarbeit in interkommunalen Planungsprozessen ein. Unsere Analysen ermöglichen es den Forschungspartnern, ihre Maßnahmen passgenau und empirisch fundiert zu konzipieren – und den Modellregionen, konkrete Veränderungen vorzubereiten.

Ausblick
Damit dieser Berg an gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnissen nicht ungenutzt bleibt, geht unsere Arbeit natürlich weiter. In der zweiten Jahreshälfte wollen wir die Ergebnisse an die richtigen verwaltungspolitischen Verantwortungsträger der Modellregionen bringen und gemeinsame Handlungskorridore diskutieren. Wir haben gemerkt, es gibt den Willen zur Veränderung – und manchmal beginnt Wandel nicht mit einem großen Wurf, sondern mit einer offenen Diskussion am Konferenztisch. Diese ersten Schritte sind entscheidend. Denn eine Verkehrswende, die ernst gemeint ist, braucht mehr als nur gute Pläne – sie braucht funktionierende Strukturen, tragfähige Kooperationen und Offenheit für neue Formen der Zusammenarbeit.
Text: Philipp Kuscher & Jakob Denker
Fotos: SHI | Jakob Denker
